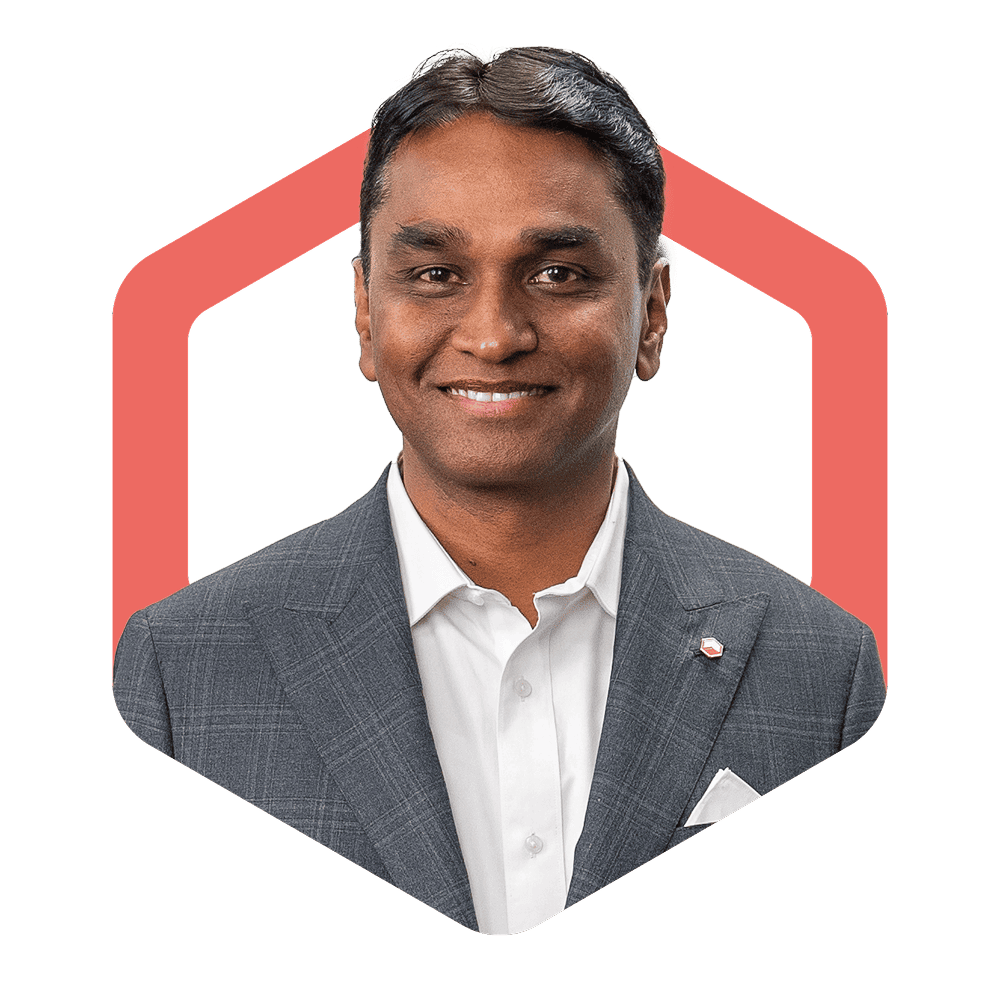LOV.ING | Musik und Ingenieurskunst
10.09.2025
Essay

Eine Melodie kann uns beruhigen, ein Rhythmus antreiben, ein Refrain in Schleifen halten, ein Crescendo emporheben.
Klassische Musik macht nachdenklich, House treibt uns in Bewegung, Pop setzt uns in Loops, während aufsteigende Linien den Blick nach oben öffnen.
Jede Kultur hat ihre eigene Klangsprache: Indien kennt die zyklischen Ragas, Afrika die Polyrhythmen, Europa die Harmonie und den Kontrapunkt. Unterschiedlich im Ausdruck und doch verbunden durch ein universelles Prinzip: Frequenz.
Musik ist vielleicht die älteste Ingenieurskunst der Menschheit. Sie formt aus Schwingungen Systeme, die uns bewegen.
Frequenzen, die Kulturen verbinden
Musik war nie nur Unterhaltung. Sie war Brücke. In Indien des 16. Jahrhunderts brachte der Mogul Akbar den Musiker Tansen an seinen Hof. Oft als „indischer Mozart“ bezeichnet. Seine Aufgabe war nicht bloß, Schönheit zu erzeugen, sondern Kulturen, Religionen und Sprachen durch Klang zu verbinden. Musik als Politik, Spiritualität und Ingenieursleistung zugleich.
Dieses Prinzip gilt noch heute: Was der indische Mozart mit Klang tat, tun wir mit Technologie, Architektur und Organisation. Wir gestalten Frequenzen, die Resonanz stiften.
Da Vinci, Beethoven und Tesla - drei Architekten der Frequenz
Drei Gestalten zeigen, wie tief Musik und Ingenieurskunst ineinander greifen:
- Leonardo da Vinci zeichnete Flugmaschinen wie Melodien. Linien, die aufsteigen, sich wiederholen, rhythmisch geordnet. Er war Maler, Ingenieur, Musiker und dachte wie ein Komponist, der Schwingung in Mechanik übersetzt.
- Ludwig van Beethoven komponierte gegen die Stille seiner eigenen Taubheit. Seine Symphonien sind Architektur im Klangraum: Brücken, Türme, Spannungen, Auflösungen. Er zeigt: Musik ist nicht außen, sondern innen. Resonanz im Selbst, die Gestalt annimmt.
- Nikola Tesla formulierte den Satz: „Willst du das Universum verstehen, denke in Energie, Frequenz und Schwingung.“ Für ihn war Technik nicht nur Funktion, sondern Harmonie mit dem Kosmos.
Alle drei verkörpern die Wahrheit: Ingenieurskunst und Musik sind Geschwister. Beide bauen Resonanzräume.
Selbstbewusstsein ist Frequenzklarheit
Wir kennen das Funkeln, wenn ein Ton uns trifft. Manchmal geschieht es in einer bestimmten Frequenz - wie bei 532 Hertz, jener Schwingung, die wir im Film bewusst eingesetzt habe. Sie ist mehr als ein Klang: Sie setzt Selbstbewusstsein frei, nicht als Ego, sondern als innere Klarheit.
Denn Selbstbewusstsein ist Frequenzklarheit. Es ist der Moment, in dem wir unseren eigenen Grundton hören - ohne Verzerrung, ohne Maskierung.
Und doch schlägt jedes Herz anders. Ein Ingenieur mag schneller schlagen, ein Künstler langsamer. Organisationen sind wie Orchester: viele Herzen, viele Tempi. Ziel ist nicht Gleichschritt, sondern Kohärenz, damit die Vielfalt in ein gemeinsames Feld klingt.
In der Medizin spricht man von Herzfrequenzvariabilität. Sie zeigt, wie lebendig ein Organismus ist. Monotonie bedeutet Starrheit, Variabilität bedeutet Resilienz. Dasselbe gilt für Organisationen: Sie brauchen Herzvariabilität, um lebendig zu bleiben.
Organisation als Orchester
Jede Organisation spielt ihre eigene Musik. Manche klingen wie eine Marschkapelle: laut, diszipliniert, synchronisiert. Andere wie ein Jazz-Ensemble: frei, improvisierend, chaotisch.
Die Frage für Führung lautet: Welche Musik wollen wir spielen?
Führung ist Orchestrierung. Es geht darum, Stimmen zu hören, Dissonanzen auszuhalten, Pausen zu setzen, Crescendi zu ermöglichen. Resonanz ist mehr als Harmonie: Sie bedeutet, dass Schwingung übertragen wird, dass etwas mitschwingt und verstärkt zurückkommt.
In der Physik wie in der Kultur gilt: Resonanz vergrößert. Darum ist entscheidend, in welcher Frequenz wir senden.
Stille, Dissonanz, Variationen
Musik lehrt uns drei weitere Führungslektionen:
- Stille: Pausen sind Teil der Komposition. Raumhalten ist kein Luxus, sondern Struktur.
- Dissonanz: Konflikte sind wie Spannungen in der Musik. Sie sind kein Fehler, sondern Versprechen auf Auflösung.
- Variation: Ein Motiv wird nicht mechanisch wiederholt, sondern variiert. Auch Organisationen brauchen Wiedererkennbarkeit ohne Monotonie.
Der Moment des Mischens
Als wir die Musik für unseren Film entwickelten, habe ich gespürt, wie konkret Frequenz wirkt. Wir haben bewusst darauf geachtet, dass die Komposition aufsteigend ist und dass die Musik sich hebt, statt zu fallen. Klänge wurden aufeinander geladen, so wie Systeme in der Technik sich verstärken.
Besonders schön war der Moment, als wir indische Tabla-Rhythmen mit westlicher Harmonie kombinierten. Zwei Traditionen, zwei innere Welten von mir und plötzlich entstand ein Raum, der größer war als beide für sich. Eine neue Resonanz, geboren aus dem Mut, Unterschiede klingen zu lassen.
In dem Moment wurde mir bewusst: Auch die Ingenieurskunst ist ein Verbindung. Sie lebt davon, verschiedene Elemente aufeinander zu legen, bis ein neues Ganzes entsteht.
Wir haben drei verschiedene Songs entwickelt. Zwei fanden ihren Platz im Film. Doch Loving trägt eine eigene Bedeutung, die über die Musik hinausgeht
lov.ing, der Klang der Verbindung
Für mich ist „lov.ing“ kein sentimentales Wort.
Es ist die Fähigkeit, Schwingungen aufzunehmen und zu verstärken.
In der Physik nennen wir es Resonanz, wenn etwas mitschwingt und zurückkommt.
In Organisationen nennen wir es Führung, wenn Herzen und Köpfe nicht im Gleichschritt, sondern im Einklang sind.
Renaissance der Ingenieurskunst
Vielleicht ist das die Renaissance der Ingenieurskunst: sie nicht mehr nur als Mathematik zu sehen, sondern als bewusste Klanggestaltung.
Wenn wir Projekte, Systeme oder Organisationen bauen, komponieren wir in Wahrheit eine Musik. Mal sind es Takte der Präzision, mal Melodien der Menschlichkeit.
Und so stellt sich am Ende nicht die Frage: Was bauen wir?
Sondern: Welche Musik lassen wir die Welt hören?
Über den Autor

Suwi Murugathas
CEO
Weitere interessante Insights

Agile Transformation – Daimler Buses auf dem Weg zur Elektromobilität
Die Umstellung von klassischen Antrieben auf vollelektrische Busse gehört zu den größten Transformationen der Automobilindustrie.
Für Daimler Buses bedeutete dies nicht nur neue Technologien, sondern auch einen grundlegenden Wandel in Organisation, Kultur und Zusammenarbeit.

Signifikante Steigerung an überholten Panzermotoren
Der drastische Anstieg des Bedarfs an überholten Panzermotoren in kürzester Zeit erfordert ein Umdenken entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Vom Vertragswesen über die Supply Chain bis hin zur operativen Umsetzung in den Produktionslinien. Rolls-Royce Solutions transformiert sich in diesem Bereich von der klassischen Werkstatt hin zur Kleinserienfertigung, bei gleichzeitiger Beherrschung der hohen Komplexität des Reparaturgeschäfts.

Lokalisierung der Ersatzteilproduktion für Großschiffsmotoren in Indien
Die indische Regierung rief im Jahr 2014 die strategische Initiative „Make in India“ ins Leben, um die lokale Produktion zu stärken und die inländische Wertschöpfung nachhaltig auszubauen. Vor diesem Hintergrund wurde ein Projekt initiiert, das die Lokalisierung von Ersatzteilen für einen ausgewählten Motor eines strategisch wichtigen Kunden vorantreibt.
Ziel ist es, Importabhängigkeiten zu reduzieren und den Anteil indischer Zulieferer entlang der Wertschöpfungskette gezielt zu erhöhen.